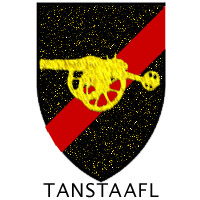Schwarzenegger, Total Recall (2012)
Ein Mann kauft sich eine Boeing 747. Allein daraus könnte man ein Buch
machen. In der Autobiographie Arnold Schwarzeneggers ist dies kaum mehr
als eine Randnotiz.
Ja, Arnold hat ein Buch geschrieben. Es ist übrigens sein sechstes. In seiner totalen Erinnerung (Total Recall) berichtet der steirische Stier von seiner atemberaubenden Erfolgsstory. Seine Erzählung folgt der Logik des Bodybuilders. Jedes Kapitel eine neue Pose. Jede Pose ist perfekt einstudiert. Immer höher klettert der Junge aus den Bergen. Immer neue Ziele, immer neue Erfolge. Jede Sprosse hätte doch die letzte sein sollen, denkt man beim Lesen. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Du hast es nach München geschafft, jetzt nach Amerika! Du bist Filmstar, Millionär und Mr. Universum, hast einen Sport neu definiert, handelst mit Immobilien, heiratest eine Kennedy, hast eine Restaurantkette, wirst Gouverneur von Kalifornien und kaufst dir einen Jumbo-Jet.
Ja, Arnold hat ein Buch geschrieben. Es ist übrigens sein sechstes. In seiner totalen Erinnerung (Total Recall) berichtet der steirische Stier von seiner atemberaubenden Erfolgsstory. Seine Erzählung folgt der Logik des Bodybuilders. Jedes Kapitel eine neue Pose. Jede Pose ist perfekt einstudiert. Immer höher klettert der Junge aus den Bergen. Immer neue Ziele, immer neue Erfolge. Jede Sprosse hätte doch die letzte sein sollen, denkt man beim Lesen. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Du hast es nach München geschafft, jetzt nach Amerika! Du bist Filmstar, Millionär und Mr. Universum, hast einen Sport neu definiert, handelst mit Immobilien, heiratest eine Kennedy, hast eine Restaurantkette, wirst Gouverneur von Kalifornien und kaufst dir einen Jumbo-Jet.
Was Arnold anpackt, gelingt ihm. Nach der Hälfte
des mehr als 600 Seiten starken Wälzers ist das Muster deutlich
erkennbar. Schwarzenegger setzt sich ein völlig übertriebenes Ziel, wird
nicht ernst genommen und erreicht am Ende alles, was er sich vornahm.
Freunde und Feinde macht er sich dabei. Wichtig erscheint ihm das
zunächst nicht. Die Beerdigung des Bruders verpasst er und die des
Vaters. Erst mit den Kindern hält etwas wie Familiensinn Einzug in die
Programmierung des Terminators. Auch zu seinem außerehelichen Sohn, den
er gemeinsam mit einer Angestellten vor 14 Jahren bekam, steht er.
Anabolika verschweigt er nicht und auch seine vielen Tricks und Kniffe,
mit denen er teils hinterhältig seine Gegner im Bodybuilding und im Film
besiegte, beschreibt er.
Ach, Arnie...
Was für ein Bild bleibt nach der
Lektüre von Schwarzenegger? Viel Neues decken die Memoiren nicht auf.
Sie versammeln und ordnen die Infos über den Terminator. Keine neuen
Gerüchte finden sich und keine schmutzige Wäsche gewaschen.
Schwarzeneggers Co-Autor Peter Petre ist kein Ungeübter. Er stand schon
Alan Greenspan zur Seite, als der seine Autobiographie verfasste.
General Schwarzkopf vertraute ihm ebenso wie IBM-Chef Watson und
Ex-Verteidigungsminister McNamara ([...]) Das zeigt, wie die
Autobiographie einzuordnen ist. Denn eine klassische Promi-Biographie
ist das nicht und auch kein Selbsthilfeleitfaden. Schwarzeneggers Buch
ist eine politische Biographie. Hier schreibt jemand, der noch immer
Ziele hat. Dutzende Male beschreibt Schwarzenegger, wie sehr ihn
unerreichbare Ziele reizen und wie gerne er etwas zum ersten Mal macht.
Doch welches politische Ziel kann jemand haben, der schon Gouverneur war
und nicht Senator werden möchte? Schwarzenegger im Weißen Haus?
Unmöglich! Laut Verfassung können nur Amerikaner Präsident werden, die
in den USA geworden wurden. Da hilft kein Trick und kein Kniff.
Arnold Schwarzenegger wurde übrigens am 30. Juli 1947 in einem Teil Österreichs geboren, der zu diesem Zeitpunkt von den USA besetzt war...
Arnold Schwarzenegger wurde übrigens am 30. Juli 1947 in einem Teil Österreichs geboren, der zu diesem Zeitpunkt von den USA besetzt war...
Arnold Schwarzenegger (with Peter Petre), Total Recall. My Unbelievably True Life Story.
Taschenbuch: 646 Seiten Verlag: Simon and Schuster (2012)
ISBN-10:978-1-4516-9705-6